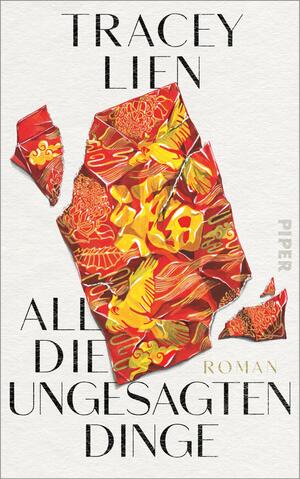
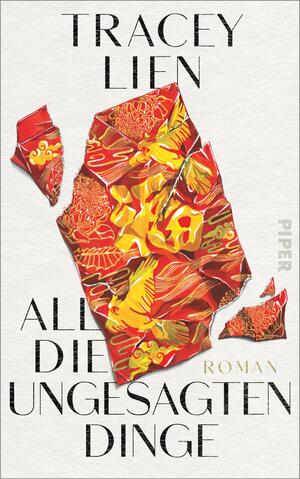
All die ungesagten Dinge All die ungesagten Dinge - eBook-Ausgabe
Roman
— Emotionaler Thriller - „Schmerzvoll und voller Schönheit.“ Julia Phillips„Ein sehr empfehlenswertes Buch über brisante gesellschaftliche Themen.“ - Bibliotheksnachrichten
All die ungesagten Dinge — Inhalt
„Lasst ihn doch gehen.“
Die junge Ky, Tochter vietnamesischer Einwanderer, empfindet bittere Reue, ihren Eltern diesen Satz gesagt zu haben. Nun ist ihr Bruder Denny tot, vor aller Augen ermordet auf der Feier seines erfolgreichen Schulabschlusses. Und nach Jahren kehrt Ky nach Cabramatta zurück, einem Einwanderervorort von Sydney, wo ihre Eltern noch immer leben. Mit ihnen will sie trauern, aber sie möchte auch Antworten auf ihre Fragen: Warum schweigen alle Augenzeugen? Warum hat sich nie jemand ernsthaft um die Aufklärung dieser Tat bemüht? Und warum hat sie selbst die Augen verschlossen vor dem Rassismus und den Ungerechtigkeiten, denen sie ausgesetzt war?
Ein Drama von großer emotionaler Wucht, getragen von unvergesslichen Figuren.
„Schmerzvoll und voller Schönheit.“ Julia Phillips
Leseprobe zu „All die ungesagten Dinge“
Kapitel 1
Die Umstände von Denny Trans Tod waren derart brutal, dass die meisten Menschen in Cabramatta vor lauter Entsetzen seiner Beisetzung fernblieben. So kam es zumindest seiner Schwester Ky vor. Die Aufbahrungshalle war nahezu leer gewesen: ihr toter siebzehnjähriger Bruder in dem geschlossenen glänzenden Sarg, ihre Eltern und ein paar Verwandte, die vor dem vergrößerten Foto eines grinsenden Denny knieten, und ein buddhistischer Mönch, der für ein Mittagessen Gebete sang.
Die einzigen Anwesenden, die nicht zur Familie gehörten, waren zwei [...]
Kapitel 1
Die Umstände von Denny Trans Tod waren derart brutal, dass die meisten Menschen in Cabramatta vor lauter Entsetzen seiner Beisetzung fernblieben. So kam es zumindest seiner Schwester Ky vor. Die Aufbahrungshalle war nahezu leer gewesen: ihr toter siebzehnjähriger Bruder in dem geschlossenen glänzenden Sarg, ihre Eltern und ein paar Verwandte, die vor dem vergrößerten Foto eines grinsenden Denny knieten, und ein buddhistischer Mönch, der für ein Mittagessen Gebete sang.
Die einzigen Anwesenden, die nicht zur Familie gehörten, waren zwei Lehrerinnen und ein Lehrer aus Dennys Highschool, die eng beieinanderstanden, staunend und verwundert, weil es weder Sitzgelegenheiten noch Trauerreden gab. Bei der anschließenden Zusammenkunft im kleinen Reihenhaus der Familie blieben sie an der Tür stehen, in den Händen noch immer die Blumen und Beileidskarten, die sie mit zur Beisetzung gebracht hatten (niemand hatte ihnen gesagt, dass vietnamesische Familien Geld annehmen), und winkten Ky, als wollten sie eine Kellnerin auf sich aufmerksam machen.
„Hi, Ky!“, sagte Mr Dickson mit unangemessen fröhlicher Stimme, den Mund weit aufgerissen, offenbar bemüht, ihren Namen richtig auszusprechen. Er hatte sie immer Kai genannt, obwohl sie ihn im achten Schuljahr berichtigt hatte, als sie viermal die Woche in seinem Matheunterricht saß. „Kiiii“, hatte sie leise gesagt, „mit langem I, wie in Igel.“ Vielleicht hatte er ja Amnesie, denn jedes Mal, wenn er die Klassenliste verlas, wurde sie wieder zu Kai, und nachdem sie ihn das dritte Mal korrigiert hatte, gab sie auf. Kii. Kai. Egal.
„Hi“, sagte Ky und machte rasch auf dem Couchtisch Platz für die Blumen.
Sie konnte spüren, wie die drei das Wohnzimmer ihrer Eltern betrachteten, alles identifizierten, was ihnen vertraut war (Fernseher von Panasonic, uraltes McDonald’s-Spielzeug aus Happy-Meal-Packungen auf dem Videorekorder, Kys gerahmter Hochschulabschluss, Fotos von Denny, wie er vier Jahre hintereinander die Auszeichnung als bester Schüler bekam), und alles, was ihnen fremdartig erschien (der Ahnenaltar mit Schwarz-Weiß-Fotos ihrer ernst blickenden toten Großeltern, ein an der Wand über dem Fernseher hängender leuchtend roter Kalender, der daran erinnerte, dass 1996 das Jahr der Ratte war, säuberlich aufgereihte Schuhe vor einer Tür). Die beiden Frauen, es waren Ms Faulkner und Ms Buck, studierten weiter den Raum, lächelten Kys kleine Cousins an, von denen einer mit einer Grimasse antwortete.
„Sind deine Eltern da?“, fragte Mr Dickson.
„Mum ist in der Küche.“
Ihre Mutter war in der Nacht zuvor aufgeblieben und hatte über hundert Klöße mit der Hand gerollt. Ky hatte mitgeholfen, auf jeden Kloß einen Tupfen rote Lebensmittelfarbe zu stempeln, aber Zweifel angemeldet, ob es wirklich nötig sei, so viel Essen zuzubereiten. Denn obwohl sie seit fast fünf Jahren nicht mehr in Cabramatta lebte, wusste sie, wie der Stadtteil funktionierte: Wenn eine Familie einen „guten“ Tod zu beklagen hatte – einen, der alte Menschen traf, einen, auf den jeder vorbereitet war –, kamen die Asiaten praktisch mit der ganzen Verwandtschaft an und überreichten Umschläge voll mit Geld. Aber wenn es ein „schlechter“ Tod war – einer, der durch ein schreckliches Unheil verursacht wurde, bei dem es um Kinder oder Gangs oder Heroin ging –, waren plötzlich alle zu beschäftigt oder gerade verreist oder hatten es zu spät erfahren. Ihre eigenen Eltern hatten sich bei Freunden und Bekannten schon ähnlich verhalten und behauptet, sie hätten nicht freibekommen, obwohl sie in Wirklichkeit fürchteten, ein solches Unheil könnte auf sie abfärben, wenn sie ihm zu nahe kamen.
„Diesmal ist es anders“, hatte ihre Mutter gesagt, nachdem Ky gefragt hatte, wer denn das viele Essen verspeisen sollte, das sie zubereiteten. Sie mied Kys Blick, als sie antwortete. Sie wollte nicht eingestehen, dass Denny einen schlechten Tod gestorben war, den schlimmsten, ein Albtraum, der ihr die Sprache raubte und ihre Familie verstummen ließ. Sie wollte nicht zur Ruhe kommen, als fürchtete sie, die Wahrheit würde sie einholen, wenn sie auch nur für einen Moment aufhörte zu arbeiten.
Ky hatte den Stempel demonstrativ auf die Arbeitsplatte fallen lassen. „Wieso ist es diesmal anders?“, fragte sie, versuchte, den Blick ihrer Mutter aufzufangen, versuchte, jemanden – irgendwen – in der Familie dazu zu bringen, ihr in die Augen zu sehen und mit ihr über ihren Bruder zu reden.
„Weil er mein Sohn ist“, sagte ihre Mutter und knallte den Teig so fest wieder auf die Platte, dass es schien, als würde ihr Körper gleich in sich zusammenfallen.
Ky hatte sich eine Erwiderung verkniffen. Sie hatte sich auf die Zunge gebissen, während ihr alle möglichen Gedanken durch den Kopf wirbelten. Daran, dass Nachbarn nicht zur Beisetzung kommen würden. Daran, dass Kollegen ihrer Eltern – die normalerweise Hochzeitseinladungen von Leuten erwarteten, die sie kaum kannten – praktischerweise zu beschäftigt für einen Beileidsbesuch wären. Wie sie Mah-Jongg miteinander spielten und gekochte Erdnüsse aßen, während sie über den guten Jungen, den schlauen Jungen, den schmerzlich bedauernswerten Jungen plauderten, der zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war. Sie sah, wie sie kopfschüttelnd darüber klagten, dass die Welt sich so verändert hatte, wie skrupellos die Menschen geworden waren, wie willkürlich das Schicksal an einem Viertel wie Cabramatta, in einem so verwirrenden Land wie Australien zuschlug. Und das machte sie wütend. Ky knirschte unwillkürlich mit den Zähnen, wenn sie daran dachte, was die Leute wohl über ihren Bruder sagten, denn was zum Teufel wussten die schon? Unheil, das war sinnlos, defätistisch. Unheil, das hieß aufgeben, bevor es angefangen hatte – eine Fußnote, etwas, das anderen Leuten zustieß. Unheil – es weckte in Ky den Wunsch, den verkrampften Mund zu öffnen und ihre abwesenden Nachbarn anzuschreien. Aber sie wusste, selbst wenn sie es versuchte, würde kein Laut herauskommen. Sie konnte immer nur davon fantasieren; sie konnte nie wirklich gehört werden.
Die Leute würden kommen, wiederholte Kys Mutter, während ihre dicken Hände den Teig kneteten und quetschten und drehten, als würde ihre Liebe zu ihren Kindern daran gemessen, wie viel Schweiß sie vergoss, wie viel Essen sie zubereitete, wie fluffig die Klöße nach dem Dämpfen waren. Die Leute würden für ihren Sohn kommen, wiederholte sie, und es wäre beschämend, dann nicht genug zu essen anbieten zu können, und die Familie konnte es sich nicht mehr leisten, beschämt zu werden.
Ky wünschte, ihre Mutter hätte recht. Denny hatte eine große Trauergemeinschaft verdient. Mehr als nur eine normale Gemeinschaft, er hatte die Anwesenheit jedes Menschen verdient, den er je kennengelernt hätte, wäre sein Leben nicht so früh zu Ende gewesen. In den Tagen vor der Beisetzung ertappte Ky sich dabei, wie sie von Hunderten, nein, Tausenden Fremden träumte, die wegen ihres Bruders nach Cabramatta pilgerten. In ihrer Fantasie drängten sie sich in der Einfahrt ihrer Eltern, reichten bis auf den Bürgersteig, verstopften die benachbarten Straßen und schrien laut, wie sehr sie wünschten, ihn gekannt zu haben. Doch obwohl sie selbst diese Tagträume erdacht hatte, verlor sie immer wieder die Kontrolle darüber, und ihr Geist ließ zu, dass Minnie, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, nicht seit sie den schlimmsten Streit ihres Lebens gehabt hatten, darin auftauchte und den Fokus auf Ky lenkte. Dann wandten sich die Fantasiepilger einmütig Ky zu, wollten wissen, wo sie gewesen war, warum sie am Ende nicht für Denny da gewesen war, wie sie derart egoistisch hatte sein können, ihren kleinen Bruder so im Stich zu lassen. Dann erstarrte Fantasie-Ky unweigerlich, ihre Tagtraumzunge wurde in ihrem trockenen Tagtraummund schwer und nutzlos, bis sie sich zwang, aus dem Traum zu erwachen.
Zurück im Wohnzimmer starrte Mr Dickson Ky an und wartete darauf, dass sie ihn in die Küche führte. Ky starrte zurück. Normalerweise wusste sie, was von ihr erwartet wurde, was sozial angemessen war, aber sie reagierte nur langsam. Es kam ihr vor, als würde sie sich selbst im Fernsehen zuschauen, anstatt ihren eigenen Körper zu bewohnen. Und in diesem Moment wollte sie sich bei der Vorstellung, Mr Dicksons Beileidswünsche für ihre Eltern übersetzen zu müssen – ganz zu schweigen von dem unangenehmen, peinlichen Gespräch, das darauf folgen würde –, am liebsten entschuldigen und weglaufen, aus dem Haus, die Straße runter, egal in welche Richtung, die Schallmauer durchbrechen und schließlich aus ihrer eigenen Haut entkommen.
„Meine Eltern sind im Augenblick beschäftigt“, sagte Ky, was keine glatte Lüge war. Ihre Mutter war noch immer im Kochrausch. Und als sie ihren Vater das letzte Mal gesehen hatte, vor rund dreißig Minuten, lag er in Begräbnishose und weißem Hemd – kaum unterscheidbar von seiner üblichen Kleidung als Bankkassierer – ausgestreckt auf Dennys Bett. „Außerdem ist ihr Englisch nicht das Beste.“
„Ich würde trotzdem gern –“
„Hier, bitte, essen Sie“, sagte Ky. „Mum hat stundenlang dafür in der Küche gestanden und wäre froh, wenn Sie kräftig zulangen.“
Sie häufte für die Lehrer Klöße und Nudeln auf Pappteller. Ihre Achselhöhlen waren so verschwitzt, dass sie sie unter ihrer weißen Button-down-Bluse quietschen hörte, und ihre randlose Brille rutschte auf dem breiten Nasenrücken nach unten. Ihre Familie bewirtete nur selten Gäste, und weiße Gäste, die nicht die Avon-Beraterin waren, stellten eine absolute Ausnahme dar. Ky konnte sich nur an ein einziges Mal erinnern, dass ein weißer Mensch sie besucht hatte: Als Denny acht war, hatte er sich mit einem sommersprossigen orangehaarigen Jungen angefreundet, der eines Tages zu ihnen kam, um G. I. Joe zu spielen. Kys Mutter, die Weißen misstraute, alle für potenzielle Diebe hielt, ließ ihn nicht ins Haus. Denny und sein Freund spielten an der offenen Tür, Denny saß drinnen, der weiße Junge draußen. Ky, die damals dreizehn war, sagte zu ihrer Mutter, sie sei ziemlich sicher, dass das nicht normal war und sie, auch wenn sie selbst keine weißen Freunde hatte, ihre Hand dafür ins Feuer legen würde, dass Sommersprosse kein Dieb war.
„Die beiden scheinen nichts dagegen zu haben“, sagte ihre Mutter und reckte den Kopf aus der Küche, um die beiden Jungen zu beobachten, die mit ihren Actionfiguren gegeneinander kämpften.
Aber offenbar hatte Sommersprosse seiner Mutter davon erzählt, und die hatte offenbar was dagegen, denn er kam nie wieder.
Minnie, die damals jeden Tag nach der Schule mit zu Ky nach Hause kam, meinte, Kys Mutter habe den richtigen Riecher. „Weiße sind Diebe“, sagte sie, während sie riesige Hubba-Bubba-Kaugummiblasen mit Traubengeschmack blies. „Captain Cook! Christoph Kolumbus! Die Franzosen! Die Weißen sind schon immer voll die Gauner gewesen, Mann.“
„Was redest du da?“, sagte Ky.
Minnie schlug sich klatschend an die Stirn und verdrehte die Augen. „Gott, Ky, jetzt haben sie dir auch noch den Grips geklaut.“
„Wieso?“
„Deine Mum ist nicht verrückt, Mann …“, Minnie zielte mit einem Finger auf Ky, „sie ist clever.“
Einerseits ärgerte sich Ky, weil Minnie anscheinend immer zu ihrer Mutter hielt, aber insgeheim war sie froh darüber, dass ihre Freundin ihr das Gefühl gab, normal zu sein. Später, wenn Ky ihren weißen Freunden am College Geschichten über ihre Eltern erzählte, versuchten die nie, ihr zu versichern, dass ihre Familie genau wie jede andere Flüchtlingsfamilie war, dass ihre Werte und Verhaltensweisen typisch waren für Immigranten aus Vietnam. Stattdessen meinten sie, ihre Mutter klinge paranoid und solle vielleicht mal eine Therapie machen. Und immer, wenn Ky innerlich gegen diese Einschätzungen rebellierte, wurde ihr klar, dass es in gewisser Weise ein Verrat war, die Geschichten ihrer Familie weiterzuerzählen, weil sie ihre Eltern damit in den Augen von Außenstehenden zu Versagern machte, weil sie diese Außenstehenden – die keine Ahnung davon hatten, was ihre Eltern durchlebt hatten oder wie groß ihre Liebe zu ihren Kindern war oder dass Vietnamesen einfach manches anders machten – förmlich dazu einlud, über sie zu lachen und nicht mit ihr. In solchen Momenten fehlte ihr Minnie besonders.
„Und? Wie lange bleibst du?“, sagte Mr Dickson, der einen Klumpen Nudeln auf seine Plastikgabel drehte, als wären es Spaghetti. Sein Blick glitt von Ky zu dem Fernsehbildschirm hinter ihr, wo eine Grafik zu dem wachsenden Loch in der Ozonschicht zu sehen war.
„Wie bitte?“ Ky wurde schlagartig aus ihren Gedanken gerissen.
„Die haben gerade darüber geredet, wie schlimm das Loch in den Achtzigern war“, sagte Mr Dickson und deutete mit dem Kinn auf den Fernseher. „Nicht zu fassen, dass wir jetzt in den Neunzigern sind und noch immer nichts begriffen haben.“
Ky wandte sich zum Fernseher um, wo der Nachrichtensprecher jetzt eine Reportage über die bevorstehende Waldbrandsaison ankündigte.
„Mh“, sagte sie und drückte den Rücken durch, weil sie nicht wusste, was sie sonst machen sollte. „Stimmt.“
„Jedenfalls“, sagte Mr Dickson, nachdem er einen Mundvoll Nudeln heruntergeschluckt und seine Aufmerksamkeit wieder auf Ky gerichtet hatte: „Ich habe gerade gefragt, wie lange du bleibst.“
Zu Kys Überraschung wusste er also, dass sie nicht mehr in Sydney lebte. Aber natürlich hatte Denny das seinen Lehrern erzählt. Er war voller Bewunderung für ihren Umzug nach Melbourne gewesen, ihr Volontariat bei der Herald Sun, ihre ersten gedruckten Artikel. Er hatte sogar gefragt, ob er nicht bei ihr wohnen könnte, nur für ein Weilchen, um herauszufinden, wie das Leben außerhalb von Cabramatta wäre. Sie hatte gesagt, sie könnten darüber reden, wenn sie das nächste Mal nach Hause käme. Sie hatte nicht gedacht, dass sie zu seiner Beisetzung kommen würde.
„Ich hab eine Woche Urlaub genommen, aber mein Chef meint, ich könnte nötigenfalls auch länger bleiben.“
„Deine Eltern sind bestimmt froh, dass sie dich hier haben“, sagte Ms Buck. Ihr Haar war noch immer so rotblond, wie Ky es in Erinnerung gehabt hatte, aber ihre Sommersprossen schienen sich im Laufe der Jahre verbündet zu haben und bildeten jetzt große hellbraune Inseln auf ihrer ansonsten milchigen Haut. „Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie durchmachen. Es ist einfach … so furchtbar. Ich bin sicher, es bedeutet ihnen viel, dass du bei ihnen bist.“
Ms Faulkner nickte, doch ihre Lippen blieben fest zusammengepresst, und Tränen sammelten sich in ihren blutunterlaufenen Augen.
Ky schämte sich plötzlich ihrer eigenen trockenen Augen. Sie hatte während der Trauerfeier nicht geweint. Ebenso wenig wie ihre Eltern.
Du weißt doch wohl, was die denken, oder?, sagte eine Stimme in Kys Kopf. Irgendwas an der Rückkehr nach Cabramatta sorgte dafür, dass Minnie in allen Gedanken Kys, in all ihren Gesprächen auftauchte. Sie konnte sich nicht an ein Cabramatta ohne Minnie erinnern, und die Stimme ihrer Freundin meldete sich stets, wenn sie am wenigsten damit rechnete. Die glauben, es ist dir scheißegal.
Das stimmt nicht, dachte Ky.
Und ob das stimmt. Die denken, du bist eine stoische, gefühllose Asiatin und hältst dich an deinen Konfuzius-Regeln fest.
Was willst du eigentlich damit –
Du weißt schon, die, wo Kon-fu-zius sagt, Weinen ist was für Bay-biies.
Ky wollte den Lehrern unbedingt erklären, nur weil ihre Eltern und sie nicht weinten, bedeutete das noch lange nicht, dass sie nicht trauerten. Tatsächlich gab es so viele Anzeichen dafür, dass sie trauerten, so viele Hinweise darauf, dass sie litten – der Nebel in den Augen ihrer Mutter, der nicht mehr weichen wollte, seit sie von Dennys Tod erfahren hatte; das Schweigen ihres Vaters, nicht weil er nicht reden wollte, sondern weil er offensichtlich keine Worte mehr fand; der verkniffene Mund und das endlose Schwitzen und ohnmächtige Fantasien und eingebildete Gespräche mit einer Freundin, die gar nicht da war. Die Familie Tran trauerte. Aber sie war wie ausgehöhlt.
Keiner hat dich gefragt.
Was?
Ehrlich, Ky, du musst diesen Lehrern einen Scheiß erklären. Die haben nicht gefragt, und es geht sie nix an.
Aber –
Lass es einfach.
„Was kommt denn jetzt als Nächstes?“, fragte Mr Dickson und drehte weiter geistesabwesend seine Gabel.
„Ich weiß nicht, ob nach dem Empfang noch irgendwas stattfindet“, sagte Ky, die endlich in die reale Welt zurückkehrte, auf reale Fragen antwortete.
„Habt ihr …“, sagte er mit einem Seitenblick auf Ms Faulkner und Ms Buck, bevor er sich wieder seinen Nudeln widmete, „noch irgendwas gehört? Was genau passiert ist?“
Ky bemerkte, dass Ms Buck von einem Bein aufs andere trat, dass Ms Faulkner sich auf die Unterlippe biss, während sie nach unten auf ihren Teller mit Nudeln starrte. Alle drei mieden Kys Blick.
Die Fakten, die Ky aus zweiter Hand von ihren Eltern hatte, waren dürftig, und wenn sie daran dachte, wurde ihr kalt, während sie weiter schwitzte. Ihre Mutter hatte ihr erzählt, dass Denny nach seinem Schulabschlussfest in ein schickes Fischrestaurant namens Lucky 8 gegangen war. Es war das erste und einzige Mal, dass Kys Eltern ihm erlaubt hatten, mit Freunden abends auszugehen – als Belohnung für seine guten Schulleistungen –, und das auch nur, nachdem er monatelang darum gebettelt hatte und Dennys bester Freund, Eddie Ho, ihnen versichert hatte, dass sie bloß einen Anlass brauchten, um ihre feinen Anzüge an dem Abend noch ein bisschen länger zu tragen. Denny hatte sogar Ky dazu gebracht, ihm in der Sache beizustehen.
„Komm schon, Mum“, hatte Ky Wochen vor dem Abschlussfest am Telefon zu ihrer Mutter gesagt. „Die gehen ins Lucky 8. Da finden Hochzeitsfeiern statt. Außerdem bin ich auch nach meinem Abschlussfest noch auf eine Party gegangen.“
„Wirklich?“
Ky stockte, überlegte, ob sie ihrer Mutter überhaupt von der Party erzählt hatte, auf der sie vor Jahren gewesen war.
„Ja“, sagte Ky und drückte die Daumen. „Mach dir keine Gedanken. Er ist praktisch erwachsen, er ist ein braver Junge, der nie irgendwelchen Ärger gemacht hat, und was soll ihm im Lucky 8 schon passieren?!“
„Aber Cabramatta ist nicht mehr so, wie es war, als du noch hier gewohnt hast“, sagte ihre Mutter auf Vietnamesisch. „Es hat sich verändert. Die Leute sind anders, als du es in Erinnerung hast, es ist –“
„Hör auf, dir so viele Sorgen zu machen, und lass ihn hingehen. Du wirst seine Entwicklung hemmen, wenn du ihn weiter einschränkst.“
Von ihrem Vater erfuhr Ky, dass das eigentliche Abschlussfest problemlos verlaufen war. Denny erhielt die Auszeichnung „Vielversprechendster Schüler“. Die dazugehörige Schärpe steckte er in die Brusttasche seines geliehenen Anzugs. Mit einer Einwegkamera machte er Fotos von Freunden, von den Lehrern der Cabramatta High, von dem fettigen und leicht angebrannten Dinner im RSL Club. Und dann gingen sie zu Fuß zum Lucky 8, einem Restaurant, das dafür bekannt war, dass dort eine Hochzeitssängerin auftrat, selbst wenn keine Hochzeitsfeier stattfand, ein Restaurant, in dem es sechs Aquarien mit lebenden Fischen und Hummern und Königskrabben gab, ein Restaurant, das für Freude und Hoffnung und Neuanfänge bestimmt war.
Was danach kam, war sowohl ihrer Mutter als auch ihrem Vater zufolge ein Unheil. Nicht einfach Pech wie ein gestoßener Zeh oder eine geklaute Radkappe, sondern eben ein Unheil, das über die Dächer schleicht und nach einer Familie sucht, die es befallen, nach einem Kind, das es rauben kann. Ky hatte ihre Eltern gefragt, was die Polizei ihnen gesagt hatte, doch anstatt ihr mitzuteilen, was sie sonst noch wussten, reagierten sie bloß mit Kopfschütteln, die Augen verquollen und rot, das Wort Unheil auf den Lippen. In dem Moment hatte Ky auch sie anschreien wollen, doch als sie den Mund öffnete – Schweigen.
„Ich weiß nicht“, sagte Ky und sah Mr Dickson endlich in die Augen. „Seit dem Vorfall haben wir nichts mehr von der Polizei gehört.“
„Tja“, sagte Mr Dickson und hörte auf, seine Plastikgabel zu drehen, „bitte sag Bescheid, falls wir irgendetwas tun, irgendwie helfen können.“
Einen Scheiß können die tun, sagte Minnie in Kys Kopf.
„Danke“, sagte Ky über die eingebildete Stimme hinweg, die im Hintergrund weitersprach.
Mr Dickson nickte mit vollem Mund. Ms Buck legte eine Hand auf Kys Schulter, und Ky musste all ihre Selbstbeherrschung aufbieten, um sie nicht abzuschütteln. Ms Faulkner sah aus, als wäre sie den Tränen nahe.
Nur für Ky hörbar sagte Minnie: Aber weißt du was? Die liebe große Schwester Ky wird mehr tun als nur einen Scheiß! Sie wird die Sache selbst in die Hand nehmen, hab ich recht, Ky? Sie wird es wiedergutmachen, dass sie ihren Bruder im Stich gelassen hat! Zum ersten Mal in ihrem jämmerlichen regelkonformen kleinen Gutmenschenleben wird sie die Initiative ergreifen! Weil diese dämlichen Cops nämlich einen Scheißdreck machen werden! Weil sie uns einfach als Problem-Migranten mit Migrantenproblemen abtun werden! Weil wenn wir nicht mal den Mund aufmachen, nachdem einer von uns totgeprügelt worden ist, dann stimmt was nicht mit uns, verdammt noch mal! Weil, weil, weil!
Als Kys Eltern anriefen, um ihr zu sagen, dass Denny im Lucky 8 zu Tode getrampelt worden war, ging sie nicht ran, weil sie nicht zu Hause war. Als sie versuchten, sie in der Redaktion zu erreichen, ging sie nicht ran, weil sie Termindruck hatte – sie sollte einen Human-Interest-Artikel über ein obdachloses Paar schreiben, das gerade im Lotto gewonnen hatte. Als ihre Eltern eine Nachricht beim Empfang der Zeitung hinterließen, kam die nie bei Ky an, weil Becca Smith, die Rezeptionistin, sagte, sie hätte wegen des starken Akzents kein Wort verstanden.
„Ich glaube, ein Chinese hat für dich angerufen“, sagte sie. „Er hat mir eine Nummer durchgegeben, aber ganz ehrlich, ich hab den kaum verstanden, deshalb hab ich sie nicht aufgeschrieben.“
„Ach so, danke.“ Ky blickte sich um, hoffte, dass jemand das Gespräch mitbekam, jemand, der ihre Gefühle bestätigen und ihr versichern könnte, dass, ja, diese Begegnung wie so viele ihrer früheren Interaktionen mit Becca Smith objektiv unangenehm war und dass Kys Reaktion – ihr Gefühl, aus dem Gleichgewicht zu geraten, als hätte jemand von hinten gegen ihren Bürostuhl getreten – nicht nur angemessen war, sondern mehr als angemessen, vielleicht sogar zu großmütig. Sie fing niemandes Blick auf. Es blieb zwischen ihr und der notorisch gut gelaunten Rezeptionistin. „Dann muss ich wohl mein Rolodex nach dem Chinesen durchsuchen und ihn zurückrufen.“
„Super! Dann viel Erfolg!“, sagte Becca Smith, klopfte mit ihren Acrylnägeln auf die Trennwand von Kys Bürowabe und lächelte steif, als hätte sie Kys Sarkasmus zwar wahrgenommen, aber nicht richtig verstanden.
Ky hörte die Sprachnachrichten ihrer Eltern nicht sofort ab. Es wäre ohnehin irgendwas Blödes, das war es nämlich immer: Denny wollte an einem Schullager teilnehmen – war das nicht gefährlich? Denny wollte in der elften Klasse Physik abwählen – würde er dann trotzdem noch Arzt werden können? Denny sollte für einen Debattierwettbewerb verreisen – war das zulässig? Ließen Teenager sich solche Lügen einfallen, damit sie stattdessen Drogen nehmen konnten?
Wenn es um Denny ging, der fünf Jahre jünger war als Ky, schien es, als hätten ihre Eltern die Fähigkeit verloren, ein Kind zu erziehen, als hätten sie vergessen, dass sie es schon einmal getan hatten, als versetzte sie die Vorstellung, es erneut tun zu müssen, in panische Angst. Die Trans hielten an der alten Heimat und dem Glauben fest, dass Jungen wertvoller waren als Mädchen. Schließlich führten Jungen den Familiennamen fort und waren traditionell die Familienoberhäupter. Selbst die besten Mädchen heirateten irgendwann und schlossen sich einer anderen Familie an. Außerdem vermutete Ky, dass ihre Eltern das Gefühl hatten, mit Denny einen Neuanfang zu haben. Denny war in Australien zur Welt gekommen, nachdem die Familie sich in Cabramatta niedergelassen hatte. Ky war ihr Trial-and-Error-Baby, aus Vietnam mitgenommen, in einem malaysischen Flüchtlingscamp von Windeln entwöhnt und vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse in Kurse für Englisch als Zweitsprache geschickt worden. Ihre Eltern bezweifelten, dass Ky Erfolg haben könnte, weil sie glaubten, sie wäre ihnen zu ähnlich. Denny verkörperte dagegen eine unbelastete Chance, für die sie keine Kompromisse machen müssten. Deshalb, so glaubte Ky, behandelten sie ihn wie ein rohes Ei und waren unfähig, Entscheidungen zu treffen, ohne zu befürchten, dadurch die Zukunft ihres einzigen Sohnes zu gefährden.
Als Denny geboren wurde, hatte Ky ihn anfangs abgelehnt, aber sie erinnerte sich an den Moment, als ihr Herz zum ersten Mal für ihn schlug: Denny, der noch Windeln trug, hockte neben einer sechsjährigen Ky, während sie die Fahnen der Länder ausmalte, die an den 1980er Olympischen Sommerspielen in Moskau teilnahmen. Ky hatte Denny verboten, ihre Buntstifte anzurühren oder mit seinen klebrigen Fingern das Arbeitsblatt anzufassen. Also hockte Denny sich neben sie, Ellbogen auf den Knien, rundliches Kinn in die Hände gestützt. Er schaute ihr still zu, das Schaben von Stift auf Papier das einzige Geräusch im Wohnzimmer, bis sie plötzlich satt und laut einen nassen Furz hörte. Ky blickte jäh von ihrem Arbeitsblatt auf und sah Denny an, dessen Mund kreisrund war, seine Augen riesengroß. Ehe sie ihn als großes dummes Baby beschimpfen konnte, das sich noch in die Hose machte, sagte er in demselben Tonfall, den die Leute in der Ajax-Reklame benutzten: „Oh nein!“ Und etwas in Ky – die Mauern, die sie gegen die Zuneigung zu diesem kleinen Bruder errichtet hatte, den ihre Eltern viel mehr liebten als sie – stürzte ein. Sie lachte und lachte, und ihre Bauchmuskeln taten weh, und sie schnappte nach Luft. Und dann lachte Denny auch, kugelte sich auf dem Fußboden und drückte dabei mit dem Hintern den nassen Haufen auseinander, sodass der Geruch aus seiner Windel drang und Ky beinahe schlecht wurde, aber sie konnte trotzdem nicht aufhören zu lachen.
In ihrer Wohnung in Melbourne, nachdem sie sich eine Pizza und ein Sixpack Bier gekauft hatte, weil sie unbedingt so werden wollte wie ihre Kollegen, deren Gesichter nicht schon nach zwei Schlückchen knallrot anliefen, hörte sie die Sprachnachrichten ab.
In den ersten drei sagte ihr Vater, der ausschließlich Vietnamesisch mit ihr sprach, sie solle ihn so schnell wie möglich zurückrufen, es sei dringend. In der vierten sagte er, Denny sei etwas zugestoßen. In der fünften, dass Denny getötet worden war, dass sie dabei waren, die Trauerfeier zu planen, dass sie so schnell wie möglich kommen musste. Seine Stimme bebte nicht, sie hörte keine Tränen. Sie ließ das Band zurücklaufen, spielte die Nachrichten von vorne ab, so oft, dass die Sätze ihren Sinn verloren. Sie fragte sich, ob sie Vietnamesisch überhaupt noch verstand – ob sie so eingerostet war, dass sie sich einfach verhört hatte, dass ihr Vater mit getötet eigentlich meinte: „hat vorzeitig seinen Abschluss gemacht, weil er so schlau ist, und warum konntest du nicht genauso schlau sein wie dein kleiner Bruder?“ Sie stellte sich ein Szenario vor, in dem Denny an der Schule gemobbt wurde. Vielleicht waren ihre Eltern besorgt und beorderten sie nach Hause, damit sie ihm beistand, seine Mobber ohrfeigte und in die Schranken wies, verlangte, dass die Schule ihren intelligentesten Schüler schützte.
„Wieso wirst du eigentlich nicht regelmäßig zusammengeschlagen?“, hatte Ky ihn ein Jahr zuvor gefragt, als er außer in Sport mal wieder in allen Fächern als Bester abgeschnitten hatte. Ky war übers Wochenende nach Haus gekommen, um Tết zu feiern. Ihre Mutter hatte ihnen aufgetragen, die Fenster im Erdgeschoss blitzblank zu putzen, damit ihr Reihenhaus für das Mondneujahr in neuem Glanz erstrahlte.
„Ich glaub nicht, dass Leute heutzutage noch zusammengeschlagen werden, weil sie Nerds sind“, hatte er gesagt.
„Ja, genau.“
„Na, du bist in der Schule ja auch nicht zusammengeschlagen worden.“
„Das war was anderes“, sagte Ky, während sie getrockneten Fliegendreck von der Scheibe kratzte.
„Wieso?“
Minnie, hatte Ky antworten wollen. In der zweiten Klasse, als ein paar weiße Mädchen sich immer, wenn sie an Ky vorbeikamen, die Augenwinkel mit den Fingern zurückzogen, hatte Minnie gedroht, der Anführerin den Kopf zu rasieren. Einen ganzen Monat lang tat Minnie jedes Mal, wenn sie die Blondies in der Cafeteria oder in der Schulversammlung sahen, pantomimisch so, als würde sie einen Kopf rasieren, und einmal sogar, als würde sie sich die Augenbrauen abrasieren, was das Oberblondie zum Weinen brachte. Da war Minnie acht. Als sie auf die Highschool kamen, war Minnie zu einem wandelnden FINGER WEG-Schild geworden, das Ky davor schützte, dass sie an den Haaren gezogen wurde, dass man ihr ein Bein stellte oder auf ihren Sitzplatz spuckte.
„Keine Ahnung“, sagte Ky. „Wahrscheinlich bin ich den Leuten einfach aus dem Weg gegangen.“
„Mach ich im Grunde genauso“, sagte Denny und nahm seine randlose Brille ab. Er hatte sich ein ähnliches Modell wie Ky ausgesucht, weil sie gesagt hatte, randlose Brillen wären intellektuell und man würde damit erwachsener aussehen. Ky fand, er sah damit wie ein minderjähriger Steuerberater aus. Er hielt die Brille an den Bügeln fest und versuchte, sie mit dem Gummiwischer zu putzen. „Ich reib es einfach niemandem unter die Nase.“
„Wie meinst du das?“
„Na ja …“ Denny hielt die Brille ins Licht und zog eine Grimasse, als er sah, dass sie jetzt noch schmutziger war als vorher. „Ich meine, klar gibt es Nerds, die zusammengeschlagen werden, aber nicht weil sie Nerds sind, sondern weil sie dauernd versuchen, allen anderen das Gefühl zu geben, sie wären blöd.“
Ky spürte einen Phantomstoß im Rücken. Sie wusste, dass Denny sie damit nicht kritisieren wollte – das war nicht seine Art –, aber es fühlte sich so an.
„Das ist sehr erwachsen von dir“, sagte Ky und schluckte trocken. „Und das da …“, sie deutete mit dem Kinn auf Dennys schmierige Brille, „ist ekelig.“
„Ich weiß, ich dachte, mit dem Wischer würd’s gehen.“
In ihrer Melbourner Wohnung drückte Ky den Anrufbeantworter an die Brust, zweifelte nicht mehr an ihrer vietnamesischen Sprachkompetenz. Sie rief ihren Vater an, bombardierte ihn mit Fragen: Was ist passiert? Wie ist es passiert? Wer war alles bei ihm? Was haben sie gesagt? Ihr Vater antwortete, sie solle einfach nach Hause kommen – über das alles könnten sie später reden. Sie saß eine Weile da, während der Käse auf ihrer Pizza erkaltete. Ky warf sie in den Mülleimer und verspürte plötzlich den Impuls, sauber zu machen. Sie zog ihre schmutzige Unterwäsche aus dem Wäschekorb, füllte das Waschbecken im Bad mit Wasser und Waschpulver und warf die Wäsche hinein, bewegte die Hände unter der Oberfläche, damit sich Schaum bildete. Sie nahm ihre eigene randlose Brille ab – die sie gekauft hatte, weil sie fand, sie sah damit erwachsen aus, wie jemand, den man ernst nehmen sollte – und bearbeitete sie mit feuchten Brillenputztüchern. Sie musste auch duschen. Als sie nackt in der Wanne stand und sich Wasser auf den Rücken prasseln ließ, überwältigte sie der Drang, die Wanne zu schrubben. Sie ging in die Hocke, Schwamm in der Hand, und verteilte cremige Klumpen Badreiniger auf Wanne und Kacheln. Dann setzte sie ihre Arme als Verlängerung des Duschkopfs ein: Das Wasser spritzte auf ihre Schultern, rann die Arme herab und tropfte von den Fingerspitzen in die Richtung, auf die sie zeigte.
Ihre Mutter hatte ihr gesagt, dass man die Luft mit einem Essigdampfbad von Keimen reinigen konnte. Aber sie hatte ihr nie das genaue Vorgehen erklärt. Also goss Ky einen Liter Essig in den Teekessel, setzte ihn auf und wartete, dass er anfing zu kochen. Während sich Schweißfußgeruch in ihrer Wohnung ausbreitete, hatte sie das Gefühl, nicht atmen zu können und gleichzeitig von innen nach außen gestülpt zu werden. Es gab so vieles, was sie sagen wollte – zu Denny, zu ihren Eltern, zu jedem, der bereit war zuzuhören. Entschuldigungen, Erklärungen, schmerzliche Beobachtungen, von denen sie wusste, dass sie tiefe Wahrheiten offenbarten. Die Worte in ihrem Kopf wollten sich hektisch ordnen, kollidierten und purzelten panisch durcheinander, und in ihrem verzweifelten Versuch zu sprechen merkte sie, dass ihr Körper nur noch nach Luft schnappen konnte. Jedes Mal, wenn sie den Mund öffnete, Luft, wieder und wieder, bis es dunkel im Raum wurde und alles verstummte und es nur noch sie gab, allein, hicksende Schreie ausstoßend, die nicht klangen, als wären es ihre eigenen, umhüllt von feuchtheißer saurer Luft.
„Dieses Buch ist viel mehr als ein Krimi: es ist, und das macht es so unglaublich gut, (…) vor allem ein Roman über die Themen Einwanderung und Rassismus.“
„Lien arbeitet nicht mit billigen Polarisationen: Sie zeigt, wie Ausgrenzung und Rassismus auch in den kleinen Gesten funktionieren, wie kulturelle Unterschiede zu ungewollten Missverständnissen führen.“
„Aufwühlendes Drama um Rassismus, Migration und Traumata.“
„Tracy Liens erster Roman erweist sich als ebenso fesselnd wie herzzerreißend.“
„Ein sehr empfehlenswertes Buch über brisante gesellschaftliche Themen.“
„Es ist eine Stärke des Buches, dass genau gezeigt wird, welche soziale Pyramide es gibt.“
„Eine sehr eindrucksvolle, berührende Geschichte, der ich viele Leser:innen wünsche!!“
„Ein einfühlsames und packendes Familiendrama.“
„Emotional forderndes Debüt“
„Ihr gelingt in ›All die ungesagten Dinge‹ die perfekte Balance zwischen einem Pageturner und einer literarischen Studie.“
„Der Reiz des fesselnden Buches liegt im cleveren Zusammenspiel von Familiendrama und Kriminalroman.“
„Es entsteht aufgrund der vielen Perspektiven ein spannender und psychologisch dicht erzählter Roman.“
„›All die ungesagten Dinge‹ ist sowohl Familiendrama als auch Kriminalroman, außerdem Milieustudie, insgesamt ein bewegender wie spannender Debütroman.“






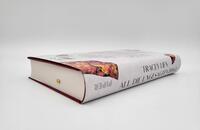















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.